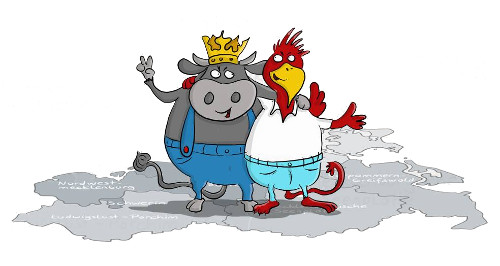Von Hier nach Dort im Strom der Zeit: Erinnerungen von Batsheva Dagan, herausgeben von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Heute: Mai 1945. Die Befreiung ist gekommen. »Wir stehen auf und beginnen, uns auf den Weg zu machen. Wohin?«
1945. Die ersten Maitage. Große Aufregung im Arbeitslager Malchow. Schon seit einigen Tagen kursieren unter uns Gerüchte, dass das Ende nahe sei. Helena hat gehört, wie Feldwebel Hahn mit seinem Stellvertreter hinter vorgehaltener Hand über die Situation sprach und sagte: »Berlin steht kurz vor der Kapitulation.«
Das Lager ist nicht mehr wie vorher. Man hat das Gefühl, die Lagerbefehlshaber haben die Fassung verloren. Wir sind noch immer Gefangene, noch immer gibt es überall Wachsoldaten, aber die Dinge sind nicht, wie sie waren. Der Hunger ist schlimmer als je zuvor. Die Vorratsräume sind leer, es gibt keine Nahrungsmittel; die Türen der Latrinen dienen als Brennstoff zum Braten der letzten Kartoffeln, die in den Vorratskammern aufzutreiben sind. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein, man wartet. Niemand weiß warum. Und dann kommt der Befehl: »Antreten! Schnell, schnell! Los! In Reihen ordnen zum Ausgang!« In seiner Folge wird das Lager hastig verlassen. Wir ziehen los und haben nichts als die ärmlichen Kleider auf unserem Körper, ohne Nahrung, ohne Wasser, mit einer einzigen Decke für uns acht Freundinnen. Die Wachleute verlassen das Lager mit uns. Sie sehen aus, als ob sie Angst haben, sie lösen ihre Abzeichen ab. »Du, komm her, mach mir die Abzeichen ab!« Sie wollen wie einfache Soldaten aussehen. Das Lager leert sich von seinen Bewohnern.
Eine Gemeinschaft von acht jungen Mädchen
Wir sind eine Gemeinschaft von acht jungen Mädchen, Lagerschwestern: Lutka, Pola, Dorka, Hanka, Estusia, Lonia, Jola und ich, Isa. Wir hatten uns verbunden, suchten Nähe, wir wollten eine Zugehörigkeit zu jemandem spüren, dem diese wichtig war. Wir gehen zwischen den übrigen Gefangenen, versuchen, einander zu unterstützen, versuchen durchzuhalten. Noch ein wenig, noch ein wenig. Wir sind abgemagert, ausgehungert und erschöpft, aber wir marschieren. Und im Laufe dieses mechanischen und erschöpften Marschierens stellen wir plötzlich fest: Sie sind schon nicht mehr da! Die Wachleute hatten sich davongemacht und uns unserem Schicksal überlassen. Es war niemand mehr da, der uns beherrschen und uns Befehle geben konnte!
Benommen von der plötzlichen Freiheit laufen wir noch eine Weile weiter und wollen uns dann ausruhen. Wir finden einen kleinen Hügel, legen uns ins Gras und decken uns alle mit der einen Decke zu. Wie gut tat es zu liegen, den Duft des grünen Grases zu riechen, die Freiheit einzuatmen, die müde Seele ein wenig ausruhen zu lassen. Am Himmel ballen sich Wolken zusammen, und es beginnt zu regnen. Wir haben keine Kraft, aufzustehen und Schutz zu suchen.
Plötzlich dringt der Lärm schwerer Fahrzeuge und menschlicher Stimmen an unsere Ohren. Das ist nicht Deutsch. Ich setze mich auf und rutsche mit aller Schnelligkeit, der ich fähig bin, zur Straße am Abhang des Hügels. Panzer! Der Lärm ist ohrenbetäubend. Die amerikanische Armee ist hier! Ist das auch kein Traum? Wir erfahren, dass der Krieg beendet ist.
Tränen der Freude und der Trauer
Tränen der Freude und der Trauer sind in unseren Augen. Umarmungen und Küsse. Die Befreiung ist gekommen. Wir sind am Leben geblieben. Es ist der 2. Mai 1945. Wir stehen auf und beginnen, uns auf den Weg zu machen. Wohin?
»Schaut! Auf den Häusern am Straßenrand sind weiße Fahnen!« Als sich die Dunkelheit herabsenkt, suchen wir uns einen Schlafplatz. Die deutschen Häuser entlang der Straße, die aus Furcht vor den Bomben der Alliierten verlassen worden waren, sind bereits voller Menschen. Auch die Scheunen sind belegt. Wir suchen weiter. In einem der Häuser steht die Tür offen. Man spricht Französisch. Ich stelle mich an den Eingang und frage auf Französisch: »Ist es möglich, heute Nacht hier zu schlafen? Wir sind acht Mädchen. Wir sind aus dem Arbeitslager befreit und wissen nicht, wohin wir gehen sollen.«
Wie gut, dass ich in Auschwitz Französisch gelernt habe, dachte ich. Damals hatten mich die Häftlinge verspottet: »Sie werden dich zusammen mit deinem Französisch verbrennen!« Und ich denke für mich: Wenn ich überlebe, werde ich die Sprache brauchen, wenn nicht, so genieße ich es heute, etwas zu tun, über das ich entscheide, das mir Freude bereitet. Und wirklich, gleich nach der Befreiung kommt mir das Französisch zugute. Die Hausinsassen sind französische Kriegsgefangene, die ebenfalls aus deutscher Gefangenschaft befreit waren. Sie beraten sich miteinander: »Was machen wir, André?« »Was meinst du, George?« Ein Augenblick des Zögerns, ein prüfender Blick auf unsere abgemagerten Gesichter und unsere dünnen Körper. Nach einer weiteren kurzen Beratung verzichten die Franzosen zu unseren Gunsten auf ihre Betten. Wir sind voller Dankbarkeit. Die französischen Kriegsgefangenen haben Pakete vom Roten Kreuz, Konservendosen, Trockenfrüchte, Kekse. Sie bieten uns davon an. Trotz der furchtbaren Müdigkeit können wir uns nicht zurückhalten und müssen alles probieren. Was für ein Genuss! Wir wissen, dass wir am nächsten Morgen mit Bauchschmerzen und Durchfall aufwachen werden. Die im Himmel verspotten uns. Endlich gibt es Essen, und es ist unmöglich, etwas davon zu genießen.
Nur weg von den Lagern und ihren Schrecken
Wie gut ist es in diesem Haus. Endlich schlafen wir wie menschliche Wesen in einem Bett mit Matratze, sauberen Laken, Daunenkissen und sogar einer Decke für jede von uns. Wir hatten schon vergessen, wie sich das anfühlt. Am Morgen bedanken wir uns bei den Franzosen und setzen unseren Weg fort. Wir wollen nur weg von den Lagern und ihren Schrecken. Wir beraten uns, wohin es gehen soll. Die Achtergruppe löst sich auf: Lotka, Lonja und Dorka entscheiden sich, nach Polen zurückzukehren, um zu sehen, ob jemand von ihren Familien am Leben geblieben ist. Ich bin in der Fünfergruppe, die weiter nach Westen will und von dort nach Palästina. Das Nahziel: Belgien, das Deutschland am nächsten gelegene Land, in dem Französisch gesprochen wird. Bei der Suche nach irgendeinem Verkehrs- mittel finden wir neben einem verlassenen Haus einen ländlichen Wagen. Unsere Reise gen Westen beginnt.
Am Tage fahren wir mit dem Wagen, und bei Einbruch der Nacht suchen wir Zuflucht in einem der verlassenen deutschen Häuser. In vielen Häusern hängt ein Hitlerbild. Die Speisekammern sind voller Nahrungsmittel, überwiegend hausgemacht – Brot, Marmeladen, eingemachte Pilze, saure Gurken, himmlische Delikatessen. Das Wetter ändert sich. Regen und Sonne im Wechsel. Auf den Straßen fahren Wagen. Auf jedem Wagen hängen Fahnen aus europäischen Ländern, einem Europa, das von der Naziherrschaft erschüttert wurde. Grüße wie Guten Morgen, Guten Tag und Gute Nacht sind in den verschiedenen Sprachen zu hören: »Bonjour«, »Dobroje utro«, »Dzien dobry«, »Dobre räno« und so weiter. Auf jedem Wagen eine Fahne. Unser Wagen hat keine Fahne. Man muss eine Lösung finden, damit man uns nicht, Gott behüte, für deutsche Flüchtlinge hält. In einem der verlassenen Häuser finden wir eine gelbe und eine rote Bluse. In einem anderen Haus finden wir eine schwarze Bluse und Nähzeug. Wir schneiden drei Rechtecke zu, nähen sie nebeneinander – rot, gelb und schwarz -, und schon haben wir eine belgische Fahne. Wir binden sie an einen Zweig und schwenken sie über unserem Wagen. Nun wird man uns nicht mehr für deutsche Flüchtlinge halten.
Drei Wochen Fahrt nach Westen, jede Nacht in einem anderen verlassenen Haus, die meiste Zeit unter der belgischen Fahne und im Herzen die Sehnsucht nach unserer eigenen Fahne, mit unserem eigenen Symbol, dem unseres eigenen Landes.
Eine unserer Stationen ist Schwerin
Eine unserer Stationen ist Schwerin, wo ich einige Monate lang als Haushaltshilfe bei einer Nazifamilie gearbeitet hatte. Um mein Jüdischsein zu verbergen, lebte ich unter falscher »arischer« Identität mit dem Namen Janka. Der Hausherr war der Bezirksgerichtsdirektor, seine Frau war Mitglied in einer Organisation von Nazifrauen. Es war ein dreistöckiges Haus, und ich hatte dort ein kleines Zimmer mit schräger Decke und einem Fenster zum See — dem Ostorfer See. In diesem Zimmer träumte ich jede Nacht, dass ich zu meinem wirklichen Namen zurückkehrte — und zu meiner Mutter. Das Band mit dem Magen David (Davidstern), das in den Tagen des Ghettos auf meinen rechten Ärmel genäht worden war, verwandelte sich in meiner Fantasie in eine richtige Fahne, die im Winde flatterte, und ich schaute sehnsüchtig auf sie.
Um sechs Uhr morgens pflegte ich aufzustehen, um Hausarbeit zu verrichten. Als Erstes musste ich die Heizung, die sich im Keller befand, in Gang setzen. Die Holzscheite hatte ich im Voraus vorbereitet. Im Gästezimmer links vom Eingang hing ein Hitlerbildnis, das ich täglich abstauben musste. Sie hatten einen Staubsauger, etwas, das es in meinem Elternhaus noch nicht gegeben hatte. Sein Betrieb verursachte einen Lärm, der es mir erlaubte, ein paar hebräische Lieder vor mich hin zu singen, die ich in der Jugendbewegung gelernt hatte. Auf Hebräisch singen! Zu sein, wer ich war, wenn auch nur für wenige Augenblicke!
»Hopp, Fräulein Janka, Bordstein!«
Zweimal die Woche nachmittags hatte ich ein paar Stunden frei und konnte in die Stadt gehen. Dort, in einem Hotel neben dem Bahnhof, sah ich polnische Frauen, die aus Polen zur Zwangsarbeit verschleppt worden waren. Das Schicksal war ihnen gnädig gewesen, sie hatten relativ gute Arbeit als Zimmermädchen. Zu diesem Hotel kam auch ein junger Mann, ein Tscheche, Vaclav hieß er, der in einer Metzgerei als Schlachter arbeitete. Wir freundeten uns an, und er war wie ein Kamerad für mich. Wir sprachen Polnisch und Tschechisch. Ich verstand fast jedes seiner Worte, die Worte klangen in meinen Ohren wie Worte, die aus meiner Sprache, dem Polnischen, kamen. Wir gingen auf der Straße spazieren. Am Bordstein, beim Überqueren der Straße, pflegte Vaclav meinen Arm zu nehmen und zu sagen: »Hopp, Fräulein Janka, Bordstein!«
Wir setzten uns auf eine Bank an der Straße, und er lehrte mich ein tschechisches Liebeslied, dessen Worte in etwa die folgenden sind:
Führ’ die Eisenbahn zum Himmel ach, so wär’ das ein Genuss,
jeder Bahnhof, wo wir hielten, dort gäb’ ich Dir einen Kuss.
Dich, die Liebe meines Lebens, werd’ ich schaukeln auf den Knien, wenn wir als ewig Paar am Himmel zu Zweit dort unsere Bahnen zieh’n.
Ho piti ho piti ho,
Dich, die Liebe meines Lebens,
ho piti ho piti ho,
werd’ ich Schaukeln auf den Knien!
Die Tage vergingen, Wochen und Monate in der Nazifamilie. Ich hatte das Gefühl, dass sie am Ende meine Identität herausfinden würden, ich wusste, dass ich in eine andere Stadt fliehen musste, doch die Angst vor dem Kommenden lähmte mich. Ich wagte es nicht, den Ort zu verlassen. Und eines Tages geschah das Schrecklichste.
Schläge an der Tür. Ich öffnete. Am Eingang stand ein großer, breitschultriger Mann, in seiner Hand hielt er eine Dokumenten-Mappe. Wie heißen Sie?« »Janina.« »Ich wiederhole, wie heißen Sie?« Er stellte die Frage wieder und wieder. Auf dem Blatt Papier, das auf seiner Mappe lag, sah ich meinen wirklichen Namen: Isabella Rubinsztajn. Sollte kommen, was da wollte. Meine Kraft war am Ende und ich konnte nicht mehr jemand sein, der ich nicht war. Ich empfand eine gewisse Erleichterung, trotz all der schrecklichen Angst.
Ich wurde zum Verhör zur Gestapo gebracht. Beamte traten ins Treppenhaus, um die Jüdin, die man geschnappt hatte, zu sehen. Ich wurde verhaftet und in drei verschiedene Gefängnisse geschickt, und von dort nach Auschwitz.
***
Und nun, auf meiner Wanderung nach Westen, bin ich wieder hier, in der Stadt, in der ich als Haushaltshilfe arbeitete. Dies ist der Ort, dieselbe Straße, dasselbe Haus. Slüterufer Nummer 12. Jola ist bei mir. Ich will ihr das Haus zeigen. Erinnerungen überkommen mich.

Der Suppenlöffel mit dem Monogramm des Namens A.T. — Anna Teitke
Ich klopfe an die Tür. Es öffnet die Großmutter, die ich kannte, die Mutter der Hausfrau. Sie ist überrascht von meinem unerwarteten Erscheinen und sagt: »Ich dachte, dass du … chhhh …« und macht mit der Hand eine eindeutige Bewegung. Ich gebe ihr zur Antwort: »Ich lebe noch, trotz allem!« Die Großmutter erwidert: »Hitler, unser Führer, hat uns betrogen.« Ihre Augen sind voller Schmerz. »Warte einen Moment, ich will dir etwas zeigen.« Sie verlässt die Eingangsdiele und kehrt mit einem Foto von mir zurück, das sie zur Erinnerung aufgehoben hat. Ich bitte um die Erlaubnis, mit Jola hinaufzugehen in das kleine Zimmer mit der schrägen Wand und dem Fenster zum See, demselben See von damals. Das christliche Gebetbuch, das auf dem Nachttisch gelegen hatte, ist verschwunden, der Kleiderschrank ist leer, die Waschschüssel und die Wasserkanne aus Porzellan sind ebenfalls nicht mehr da. Noch ein Blick auf den See und ich bin wieder bei der Großmutter. Bevor ich das Haus verlasse, gibt sie mir die Fotografie, die einzige, die übrig blieb von einer zerstörten Welt, sowie einen Suppenlöffel mit dem Monogramm ihres Namens: A. T., Anna Teitke.
Ich verlasse das Haus, in dem ich einst in ständiger Angst gelebt hatte, dass sie mich schnappen, dass sie am Ende meine Identität entdecken würden. Ich empfinde ein Gefühl des Triumphes. Jola ist meine Zeugin. Die Worte der Großmutter hallen mir in den Ohren: »Hitler, unser Führer, hat uns betrogen.« Alle Mitglieder ihrer Familie waren begeisterte Anhänger von Hitler. Ein Lied kommt mir in den Sinn, das die marschierenden Soldaten auf den Straßen sangen:
Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt,
Und heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.*
* Das Lied von Hans Baumann »Es zittern die morschen Knochen« von 1932 war ein beliebtes Marschlied der SA und des Reichsarbeitsdienstes.
Lesetipp

Batsheva Dagan: Von hier nach Dort im Strom der Zeit. Magdeburg 2018. Herausgeber: Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt
Kostenfrei zu bestellen – hier
Leseprobe: Meine Socken, ein Museumsstück
Leseprobe: Das Bild aus dem Ghetto Warschau
Hintergrund

Wie erzählt man Kindern vom Holocaust?
Die Zahl auf ihrem linken Arm, ob das eine Telefonnummer wäre, wurde sie im Kindergarten mal gefragt. 45554. Nein, antwortete Batsheva Dagan. Und erzählte von ihrer Zeit im KZ. Kindern vom Holocaust? „Gerade Kindern“, sagt sie. Weiterlesen